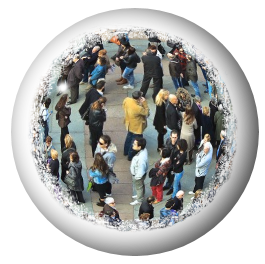Die Dorfschule ist verschwunden. Ebenso der Dorfladen. Zwar steht die Kirche noch im Dorf, doch der Pfarrer kommt höchstens einmal monatlich zur Predigt. Die Jungen zogen weg. Und doch: Viele wehren sich mit Händen und Füssen (will heissen Abstimmungsbeschwerden und Rekursen) gegen das Zeitgebot: Gemeindefusion.
Zwar verständlich, aber chancenlos
In unserer kleinen föderalistischen Schweiz steht die Kleingemeinde als Fundament der Heimat. Da wird politisiert, man kennt jeden Winkel, fast jeden Bewohner, jede Bewohnerin. Da wird abgestimmt nach Regeln aus dem vorigen Jahrhundert oder früher und gewählt nach … (das lassen wir mal offen). Nicht verwunderlich, tut man sich schwer mit der Schaffung zeitgemässer Strukturen, wie man sie auf anderen Gebieten längst knurrend oder automatisch übernommen hat. Die Gemeindeautonomie ist heilig und hat diesen Aspekt bewahrt, besser als die Botschaften von der Kanzel. Waren es 1850 im Land noch 3203 Gemeinden, sind es mittlerweile 2220. Immerhin, sagen Sie? Bei den meisten Fusionen war nicht politische Voraussicht, sondern finanzielle Zwangslage Motivation. Dabei fühlt man sich – im Nachhinein – in Zeiten nach dem Zusammenschluss mit Nachbargemeinden weder heimat- noch brotlos. Im Gegenteil: Es öffnen sich neue Türen, neue Möglichkeiten für zukunftsträchtige Investitionen, zu Effizienzsteigerung im Kommunalbereich. Oftmals hört man dann hinter vorgehaltener Hand gar ein ehrliches, überraschendes „das hätte ich nie für möglich gehalten“. Die Widerstände sind verständlich, doch sie fokussieren auf der Vergangenheit der letzten Jahrhunderte und werden längerfristig keine Chance haben.
Die grosse Misere: Behördensuche im Milizsystem
Bald die Hälfte aller Zürcher Gemeinden kämpft gegen die Schwierigkeit, geeignete Frauen und Männer für ihre Exekutivämter zu finden. In anderen Kantonen ist die Situation noch dramatischer. Es soll an dieser Stelle nicht über die Gründe dieser Misere gerätselt werden, denn Zeitgeist, Berufsleben, Parteiengezänke tragen zweifellos alle dazu bei. Die Folgen sind gravierend: Sinkt die Qualität der schlussendlich Gewählten, verspricht das gar nichts Gutes. Werden gar Unfreiwillige verpflichtet (Amtszwang), kann von Motivation wohl keine Rede mehr sein. Werden wegen Überlastung oder Inkompetenz einzelne Bereiche ausgelagert zu professionellen Anbietern, geht ein Teil der vielgelobten Gemeindeautonomie bachab. Der „oberste“ Präsident des Zürcher Gemeindepräsidentenverbands will mit einem „Kreditpunktesystem“ das Problem angehen und äussert sich dezidiert gegen Gemeindefusionen aus dem Grund mangelnden Behördennachwuchses. Da ist zumindest ein Fragezeichen erlaubt.
Wer hats’s erfunden? Die Glarner!
Allen vorgemacht, wie das geht, hat es der Kanton Glarus, als die Landsgemeinde 2006 beschloss, die 25 Gemeinden zu drei Grossgemeinden zu fusionieren. Der Beschluss war einigermassen überraschend zustande gekommen – wie es eben nur an einer Landsgemeinde mit ihren eigenen Gesetzen möglich ist. Auch für die einstigen 18 Schul- und 16 Fürsorgegemeinden war damit das Licht ausgegangen.
Wie anderswo, musste als Vorbedingung der Leidensdruck gross sein. Wer eine Jahrhundert alte Kultur verändern will, muss vorsichtig ans Werk gehen. Doch offensichtlich ist die Strukturreform erfolgreich abgelaufen, Kosteneinsparungen, Professionalisierung, vereinfachte Rekrutierung von Behördenmitgliedern etc. wurden tatsächlich erzielt, wobei immer wieder aufflackerte, dass der finanzielle Nutzen allein nicht reichte. Das Spar- und Synergiepotenzial von jährlich sechs Millionen Franken soll jedenfalls erreicht worden sein.
Wer sich heute mit Glarnerinnen oder Glarnern über diese schweizweit einmalige und mutige Aktion unterhält, hört immer wieder Antworten wie „wer hätte das gedacht, wir hätten das nie für möglich gehalten“. Offen wird die damalige grosse Skepsis eingestanden – und umso mehr im Nachhinein ein gewisser Stolz über diese gelungene Glarner-Pioniertat. (Unwillkürlich wird man daran erinnert, dass es 1864 ebenfalls die Glarner-Landsgemeinde war, die das erste Arbeitsgesetz der Schweiz einführte. Zuvor hatte die Arbeitszeit 12 – 16 Stunden täglich, an sechs Tagen die Woche und ohne Ferienspruch gegolten, auch für Kinder!)
Gemeindefusionen entkrampfen
In den letzten 17 Jahren sind in der Schweiz jährlich durchschnittlich 40 Gemeinden „verschwunden“, am meisten 2012 mit 87. Angesichts der prekären Lage und der grossen Probleme in vielen Kleingemeinden ist das viel zu wenig. Einzelne Gemeinden setzen auf „innovative“ Konzepte: Man möchte Rentner ansiedeln, Pensionierte. Wieder andere Gemeinden locken gar mit respektablen Geldspritzen, um junge Paare mit Kindern ins Dorf zu locken und ein Eigenheim zu bauen. Anderswo locken Behörden Neuzuzüger mit Gratis-GA, Beiträgen an Krankenkassenprämien, kostenlosen Parkplätzen oder Rabatten in Dorfläden. Natürlich geht es hier um die Abwanderung, die Häuser leer stehen, Gemeindesteuereinnahmen schmelzen und Dorfbilder veröden lässt. Solchen gut gemeinten Aktionen wird leider kaum anhaltender Erfolg blühen. Den Auswirkungen des Bevölkerungsschwundes (Abwanderung) ist mit Pflästerli-Promotionen nicht beizukommen.
Zwei-Gleis-Strategie für den Gemeinde-Revival
Gehen wir mal davon aus, dass dem Bevölkerungsschwund auf zwei Gleisen zu begegnen wäre: Auf administrativem (Fusion) und auf operativem (Siedlungsstruktur). In dieser Zwangslage liesse sich wenigstens aus finanzieller und administrativer Sicht durch Fusionen mit benachbarten Gemeinden die Lage entspannen. Möglichst viele Gemeinden sollten dabei zusammenspannen, um die Synergieeffekte zu vergrössern. Nicht zu unterschätzen ist dieser emotionale Aspekt: „fusionierte“ Gemeinden behalten ihren bisherigen Dorfnamen, lediglich der Name der neuen Grossgemeinde wird zusätzlich voran- oder nachgestellt. Damit geht die tiefverwurzelte Identität nicht verloren.
Ist auf diese Weise schon mal das Fundament bereinigt, gilt es, sich auf die zweite Schiene zu begeben und alle Kräfte und Ideen auf Antworten und Lösungen für die betroffene Gemeinde in einer grundlegend veränderten Welt des 21. Jahrhunderts herauszuarbeiten, individuell, möglichst als unique selling point. Was ist einmalig am Dorf? Welche Häuser stehen leer? Was hat das lokale Umfeld zu bieten, was andere nicht haben? Warum sollten Pensionierte, Werktätige oder gar junge Familien mit Kindern hier wohnen? Welche Aspekte der digitalen Welt fänden hier eine Zukunft? Wie und wo finden sich Investoren für die Dorf-Renovation? Warum sollten diese ihr Geld ausgerechnet hier investieren? Könnten in Zusammenarbeit mit Nachbardörfern in vergleichbarer Situation Gemeinschaftswerke realisiert werden? Wer im Dorf macht mit beim Brainstorming? Alternativlosigkeit hat da keinen Platz. Kreative Geister sind gefordert.