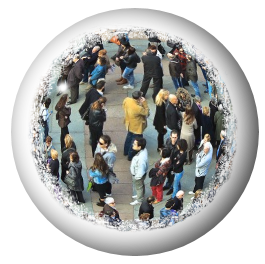174 Jahre später
174 Jahre später sieht das Bild etwas anders aus: In unserem Land leben 2,5 Mio. Katholiken und 1,6 Mio. Reformierte (neben 2,8 Mio. Menschen mit diversen Religionen oder ohne). Die Politikwissenschaftler Adrian Vatter und Andreas Ladner schreiben, «dass der Ständerat mit der Übervertretung der Katholiken heute keine kulturelle Minderheit mehr schützt, da diese mittlerweile zur grössten Konfessionsgemeinschaft angewachsen ist» (Vatter/Ladner, in: «Der Ständerat», NZZ Libro).
Verstärkt wird diese Tatsache durch die grossen Unterschiede der kantonalen Bevölkerungsentwicklung seit 1847: Während die grossen städtischen Agglomerationen einwohnermässig vergleichsweise explodierten, sind die meisten ländlichen Kleinkantone bevölkerungsbezogen in viel langsamerem Tempo gewachsen.
Es stellt sich deshalb die Frage, wen der Ständerat im Jahr 2021 eigentlich schützt.
Beschützen, bewahren, bevorzugen, beeinflussen?
Der Ständerat: Historisches Fossil oder Zukunftsmodell? So hiess eine Konferenz 2019, die im geschichtsträchtigen Saal des Ständerats abgehalten wurde. Die Fragestellung war ambitiös und lässt vermuten, dass sich schon damals kritische Politiker*innen und Wissenschaftler*innen mit der Rolle des Ständerats befassten, einer Rolle, die sich inzwischen weit entfernt hat von der ursprünglichen Idee.
Zum besseren Verständnis: National- und Ständerat haben die gleichen Aufgaben, unser Zweikammersystem – dort die Volksvertreter, hier die Kantonsvertreter – unterscheidet sich durch Zuständigkeiten und Repräsentativität. Es unterscheidet sich natürlich noch in anderer Hinsicht, darauf ist zurückzukommen. Wäre dem nicht so, müsste man sich ja fragen, warum überhaupt zwei Kammern?
Der repräsentative Ständeratssaal vermittelt das Bild des 18. Jahrhunderts: Die Landsgemeinde von Stans, Landschaft von Sarnen, die Obwaldner Alpen im Hintergrund. Manchmal fragt man sich, ob die kantonalen Abordnungen (je 2 Personen) das Bild jener Tage vor Augen haben oder ab und zu auch den Blick in die Zukunft schweifen lassen. Unter den historischen Eindrücken dieser imposanten Fresken hat sich der Ständerat über Jahrzehnte von jener historischen Konzession gleichsam auf leisen Sohlen zur innerparlamentarischen Kontroll- und Korrekturinstanz gemausert, wie man sich das wohl damals nicht hätte vorstellen können. Sein Einfluss ist nicht kleiner als jener des Nationalrats, wie oft moniert wird, er ist grösser. Auch davon später. Was hat das für Auswirkungen?
Konservativer, vergangenheitsorientierter, verharrender Einfluss
Zweifellos üben die Mitglieder des Ständerats einen eher konservativen Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung aus. Ob allerdings die wichtige Rolle des Minderheitenschutzes und der Qualitätssteigerung, ob diese Faktoren bei der Leistungsbeurteilung noch sehr wichtig sind, bleibe mal dahingesellt. Doch manch ein Mitglied der Bevölkerung dürfte sich die Frage stellen, ob «… der einseitige Schutz der kleinen Landkantone und der katholischen Bevölkerung durch den Ständerat – angesichts der weitreichenden gesellschaftlichen und politischen Veränderungen – ob dieses selektive Konfliktreglementmuster längerfristig noch gerechtfertigt sei» (Vatter/Ladner, in: «Der Ständerat»).
Nicht wegzudiskutieren ist dagegen die Tendenz der Mitglieder des Ständerats, bei Abstimmungen mehrheitlich einen bewahrenden, ja verharrenden Standpunkt zu vertreten – im Gegensatz zu den städtischen Kantonen mit starken Dienstleistungs- und Produktionszentren. In diesen Kantonen ist man darauf angewiesen, dass Gesetze und Bestimmungen fortschrittlich abgefasst und interpretiert werden.
Die Frage, wer der stärkere Rat sei, National- oder Ständerat, wurde schon beantwortet: Die Fakten sprechen für den Ständerat. Das wird auch daraus ersichtlich, dass dieser sich bei Differenzen und Änderungswünschen an bundesrätlichen Erlassentwürfen häufiger durchsetzt. Rechnet man als Dritten im Bunde noch den Bundesrat dazu, so kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass keiner der drei Räte auf nationaler Ebene die andern zwei vollständig dominiert.
Bleibt noch die Frage, worin sich National- und Ständerat unterscheiden. Wird der Ständerat, auch «Chambre de réflexion» genannt, dieser inhaltsschweren Qualifizierung noch gerecht? Denkt er politisch voraus? Gemäss Mueller/Vatter (Herausgeber, «Der Ständerat»): «Es mag kurze Phasen gegeben haben, etwa zu Beginn der 1990er-Jahre, als einige Ständeräte weitreichende Vorschläge zur Regierungsreform eingebracht haben, in denen die Zweite Kammer diesem hohen Anspruch gerecht wurde. Grundsätzlich aber überwiegt der Eindruck, dass sich Ständeräte nicht zuletzt als Folge des demokratischen Wahlmodus wie die Volksvertreter der Ersten Kammer in erster Linie an der durch Parteien geprägten Tagespolitik orientieren.» Eigentlich schade.
Föderalismus pur: das Ständemehr
Wir müssen weit zurückschauen, bis wir zu den Anfängen des Ständemehrs gelangen. Dieses liegt begründet in der historischen Autonomie der Kantone in der Alten Eidgenossenschaft. In der Bundesverfassung von 1848 wurde es verankert, indem zusätzlich zum Volksmehr das Ständemehr zwingend wurde: bei Änderungen der Bundesverfassung, beim Beitritt zu supranationalen Gemeinschaften und bei dringlich erklärten Bundesgesetzen ohne Verfassungsgrundlage mit Geltungsdauer von über einem Jahr. Relativ selten zwar, doch immerhin: Das Stände-Nein bevorzugt klar die kleinen, ländlichen und eher konservativ geprägten Kantone der deutschsprachigen Zentral- und Ostschweiz gegenüber den grossen städtischen Agglomerationen und gegenüber der französischen Schweiz.
Als Beispiel dieses demokratischen Problems: Eine Stimme aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden hat 41-mal mehr Gewicht als eine aus dem Kanton Zürich. Der Anteil jener Schweizer*innen, die das demokratisch fragwürdig finden, ist steigend. Doch sie realisieren: Alle Änderungsvorhaben dieses unbefriedigenden Zustands würde wohl am Ständemehr scheitern.
Föderalismus à la 1848 ist überholt, ja unerwünscht
Bis Oktober 2020 sind seit 1866 – also innert 15 Jahrzehnten – insgesamt 10 Vorlagen trotz Volksmehr am Ständemehr gescheitert, also weniger als einmal pro Jahrzehnt. Im November 2020 kam als 11. Auflage jene der Konzernverantwortungsinitiative dazu.
Diese Entwicklung darf, wer auf schweizerischen Föderalismus schwört, nicht länger akzeptiert werden. Wer dies nicht einsieht, schadet seiner Heimat, dem Sonderfall Schweiz, und ihrem internationalen Ansehen. Wenn wir schon so stolz sind auf die helvetische direkte Demokratie, dann wird es höchste Zeit, diese spezifische – einst gut begründete, inzwischen aber jeglichem Gerechtigkeitsempfinden zuwiderlaufende – Altlast einer zeitgemässen Funktion zuzuführen.
Vorschläge aus der Wissenschaft
Es entbehrt nicht einer gewissen Komik – ist aber gerade deswegen typisch für unser Land –, dass die in den letzten Jahrzehnten immer lauter gewordene Kritik am Ständerat, die vor 50 Jahren begann, als Leonhard Neidhart feststellte, «dass seine Repräsentation als föderalistische Vertretung nicht eindeutig genug sei und als soziale nicht der gesellschaftlichen Interessensstruktur entspreche», heute nichts an ihrer Gültigkeit eingebüsst hat (Sean Mueller und Adrian Vatter, Herausgeber, «Der Ständerat»).
Beide Professoren, die den Instituten für Politikwissenschaften an der Uni Lausanne (Mueller) respektive Bern (Vatter) vorstehen und unserer politisch interessierten Jugend den neusten Stand der Forschung nahebringen, haben 2020 diverse Modelle zur Reform des Ständerates/Ständemehrs publiziert. Sie sollen mithelfen, «unter besonderer Berücksichtigung der festgestellten Defizite des Ständerats» das «Stöckli» ins 21. Jahrhundert zu katapultieren.
Reformvorschläge:
– Erhöhung des Ständemehrs auf zwei Drittel der Kantone,
– Ausschaltung des Ständemehrs ab 55% Ja-Stimmen,
– Gewichtung der Stände nach Bevölkerungsgrösse.
Doch es ist offensichtlich, dass alle Vorschläge Vor- und Nachteile hätten. So bleibt letztlich ein kombiniertes Reformmodell als langfristige Zukunftsvision: einerseits die Stärken und hohe Akzeptanz des Ständerats zu wahren, andererseits «den Ausgleich grundlegender struktureller repräsentationsspezifischer Schwächen der schweizerischen Demokratie in den Mittelpunkt» zu rücken.
Chancen einer Reform
Das Ständemehr in der heutigen Form ist hoffnungslos überholt. Doch um dieses Relikt zu modernisieren wäre … das Ständemehr nötig. Beobachtende sind sich einig, dass wir also auf Gedeih und Verderb einem Gesetz ausgeliefert sind, das je länger, je mehr dem urdemokratischen «one man, one vote» zuwiderläuft.
Ich bin mir da nicht so sicher. Wer die Mentalität dieser ländlichen, mehrheitlich bäuerlichen Bevölkerung kennt und anerkennt, welch bewundernswerte Arbeit da vielerorts an den steilen Hängen der Schweizer Berge geleistet wird, akzeptiert Eigenheiten und Traditionen eines eigenständigen Volkes. Wenn diese Mannen und Frauen einsehen, dass sie zugunsten der grossen Mehrheit der Schweizer Bevölkerung und für ein modernes Gesetz auf ein aus der Zeit gefallenes Relikt verzichten sollten, dürften sie für eine Reform zu überzeugen sein. Sie selber wären direkt Profiteure (via eidgenössischen Finanzausgleich), wenn die grossen Industriekantone prosperieren und nicht durch unzeitgemässe politische Restriktionen zurückgebunden werden.
Wer packt die Sanierung dieser Reform-Baustelle in Bern an? Welche Partei riskiert diese Herkulesaufgabe?
Sean Mueller/Adrian Vatter (Hrsg.): «Der Ständerat», NZZ Libro